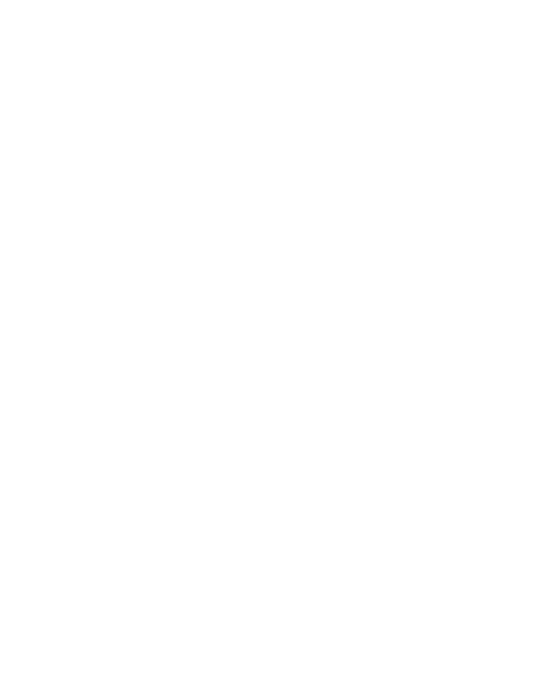Der slowakische Hersteller Canor erfreut uns schon seit Längerem mit leistungsfähiger Elektronik meist auf Röhrenbasis. Jüngst jedoch stellte sich heraus: Die können auch anders.
Endstufe Canor Audio Virtus S1S
Eine Frage des Prinzips
Zur Sicherheit habe ich nochmal nachgeguckt: Das Lineup von Canor Audio umfasst derzeit zwölf Geräte. In zehn davon schwingen Röhren den Taktstock, lediglich der Vollverstärker AI 1.20 ist ein reines Halbleiterkonstrukt. Sogar der hochmoderne D/A-Wandler-/Vollverstärker Virtus A3, mit dem wir im letzten Heft hervorragen Musik gehört haben, verzichtet nicht auf den Einsatz von zwei Doppeltrioden zum Erzielen seiner klanglichen Meriten. Und jetzt das: Ein fast 40 Kilo schweres Endstufenmonster mit richtig Leistung, dem unbedingten Willen, jedem noch so fehlkonstruierten Lautsprecher sein Diktat aufzudrücken – und ohne eine einzige Röhre.
Warum die das so machen? Ich habe keine Ahnung. Zumal Canor mit dem Virtus A3 eindrucksvoll bewiesen hat, dass man in der Lage ist, Hybridkonzepte mit satter Ausgangsleistung überzeugend zu realisieren. Wem der Formfaktor der brandneuen Endstufe bekannt vorkommt, der tut das aus gutem Grund: Die ist nämlich der „Reference Line“ des Herstellers zuzuordnen, in der sich bereits die Vorstufe Hyperion P1 und die Monoendstufen Virtus M1 tummeln. Warum man die fantastische Phonovorstufe Asterion V2 nicht mit in die Reference Line einsortiert hat, werde ich wohl nie verstehen. All diesen Geräte nämlich sind voluminöse quaderförmige Gehäuse aus dickwandigem Aluminium zu eigen, die an ihrem Top-Anspruch schon optisch keinerlei Zweifel lassen. Versuchen wir eine Argumentation für die Virtus S1S mal so: Die Röhrenmonos Virtus M1 kosten pro Paar gut 28000 Euro. Zwar mobilisieren sie mit vier Stück KT150 pro Kanal Leistung satt, sie heizen das Hörzimmer jedoch auch beträchtlich auf und generieren eine entsprechende Stromrechnung. Hinzu kommt die begrenzte Lebensdauer der acht Endröhren. Zeitgenossen mit entsprechenden finanziellen Reserven und „unheilbarer“ Röhrenabhängigkeit mag das nicht stören, etwas geerdetere Mitmenschen vielleicht schon. Für die gibt’s nun eine mit 20000 Euro sogar etwas günstigere Alternative mit noch mehr Leistung und dem Vorteil, dass man nur einen dieser Endstufenbrocken unterbringen muss. Auch die Virtus S1S produziert ein gewisses Maß von Abwärme: Die Konstrukteure spendierten ihr ein nennenswertes Maß an Ruhestrom, um möglichst viel Ausgangsleistung im vorteilhaften Class-A-Betrieb erzeugen zu können: Eine Ruheverlustleistung von 175 Watt ist kein Pappenstiel und lassen auf jede Mange Class-A-typischer Wucht und Finesse hoffen.
Von vorn gibt sich der Endstufenhüne eher pragmatisch: Einer der beiden winzigen Taster lässt das Biest aus dem Standby- Dornröschenschlaf erwachen, der andere schaltet die Helligkeit des orangefarbenen „Lichtrings“ in sechs Stufen.
 Rückseitig gibt‘s alles, was man so braucht - und Bi-Wiring
Rückseitig gibt‘s alles, was man so braucht - und Bi-Wiring Der wie bei allen Canor-Geräten vorhandene zentrale runde Knopf hat hier übrigens keinerlei weitere Funktion als die weithin sichtbare Darstellung des Firmenlogos. Auf der Geräterücksseite geht’s ebenfalls aufgeräumt zu. Am auffälligsten sind die vier kernigen Polklemmen für den Lautsprecheranschluss pro Kanal, die Bi-Wiring- Betrieb ermöglichen. Bananenstecker sind kein Problem, Kabelschuhe lassen sich mit ordentlich Drehmoment festziehen. Eingangsseitig hat man die Wahl zwischen Cinch- und XLR-Buchsen, die Umschaltung erfolgt mittels kleiner Kippschalter. Mittig auf der Rückseite finden sich der Kaltgeräte-Stromanschluss und der harte Netzschalter. Es erstaunt ob der zu erwartenden Leistungen etwas, das Canor hier auf den „kleinen“ C14-Anschluss setzt und nicht auf einen mit 16 Ampère spezifizierten C20-Verbinder. Hinzu gesellen sich Anschlüsse fürs ferngesteuerte Ein- und Ausschalten – das war’s dann.
Technik Unter dem massiven Gehäusedeckel kommen zunächst zwei beeindruckende, hochkant montierte Ringkerntrafos zum Vorschein. In der Virtus S1S herrscht strikte Doppelmono-Disziplin und die beiden Umspanner werden sich von den geforderten Leistung sicherlich nicht beeindrucken lassen. Gleichrichtung und Siebung mittels voluminöser Elkos erinnern fast an die guten alten Zeiten amerikanischer Endstufengigantomanie, auch die auf beiden Seiten präsenten Kühlkörper-Trutzburgen erinnern an die goldenen Zeiten von Krell & Co. Die Ausgangsleistung besorgen zweimal fünf parallele Leistungstransistoren pro Kanal, die auf ziemlich beeindruckenden Kupferschienen montiert sind, die sowohl für den effektiven Wärme- wie Stromtransport zuständig sind. Wie es sich für einen Verstärker in dieser Klasse gehört, selektiert der Hersteller die Endtransistoren auf Gleichheit, um eine gleichmäßige Verteilung der Leistung auf alle Beteiligten sicherzustellen. Effektivität an dieser Stelle ist oberstes Gebot, denn immerhin wollen hier fast 500 Watt Dauerleistung an vier- Ohm-Lasten stressfrei kanalisiert werden. Tumbe Hochleistungsverstärker gibt’s genug, Canor hat sich jedoch eine Menge einfallen lassen, um der Virtus S1S auch musikalische Qualitäten anzuerziehen. Neben dem Allheilmittel „Ruhestrom“ gibt’s eine symmetrische Eingangsstufe mit den immer rarer werdenden JFETs als Protagonisten, außerdem verzichtet man weitgehend, wenn ich das richtig verstanden habe, auf eine Über-Alles-Gegenkopplung. Vielmehr bekommt jede Stufe ihre eigene, rein lokal agierende Signalrückführung, die viel weniger Probleme verursacht. Viel Wert legt man außerdem auf eine extrem stabile und linear arbeitende Stromversorgung. In diesem Zusammenhang sind zwei so genannte „stromkompensierte Drosseln“ zu sehen, die sich unter einer Abdeckung im Netzteil verbergen und für mehr Stabilität und Störarmut in der Speisespannungserzeugung sorgen. Die Rechnung geht auf, messtechnisch zählt die dicke Canor zum Besten, was ich seit langer Zeit auf dem Tisch hatte. Hier beeindrucken insbesondere die imposanten Störspannungsabstände, die bei Verstärkern dieser Leistungsklasse äußerst schwierig zu erzielen sind.
Klang Was für eine leistungshungrige Riesenbox hätten wir denn gerade da, mit der man der Virtus S1S am besten auf den Zahn fühlen könnte? So richtig – gar keine. Nichts weitgehend wirkungsgradfreies mit wildem Impedanzverlauf, keine historischen Riesentrümmer mit mehr Membranfläche als Verstand. Das Paar JBL L300, das mir unlängst zugelaufen ist, steht für dieses Experiment noch nicht zur Verfügung und ob ich willens bin, der Canor eine Chance an den Bässen meiner JBL 4355 zu geben, weiß ich ob des Bandscheibenriskos noch nicht. Wie sich herausstellt, macht das aber gar nichts. Die Virtus M1 braucht so etwas nicht, um ein wahres Feuerwerk zu zünden. Ihre explosive Farbigkeit, ihre Leidenschaft und Grazie erinnern schon wieder an große amerikanische Verstärkerkunst, ich bin fast bereit, Vergleiche zu solchen Dingen wie einer Audio Research Reference 75 aus den Tiefen des Hinterkopfes zu kramen. Und das, wohlgemerkt, an Böxlein mit 17- bis 20-Zentimeter- Tieftönern, die die Leistungsfluten der Canor garantiert nicht brauchen. Nichtsdestotrotz macht es einen Höllenspaß, sich dieses Endstufenmonster an unserer Nada abarbeiten zu lassen, die den Versuch mit Stabilität, Souveränität und immenser Spielfreude honoriert. Da muss sogar der fantastische
Eversolo AMP-F10 passen, der, obschon in der fast gleichen Leistungsklasse angesiedelt, einfach nicht die Ausdrucksstärke und Überzeugungskraft der Canor mitbringt. In Anbetracht des Umstandes, dass man für eine Canor fast acht Eversolos kaufen kann, geht das jedoch völlig in Ordnung. Abermals ist es die großartige 45er-Jubiläumsausgabe von Wishbone Ash‘s „Argus“, die die Qualitäten des Setups unmissverständlich klarmacht. Ob‘s nun der feinsäuberlich aufgedröselte zweistimmige Gesang zu Beginn von „Time Was“ ist, die ganz besonders engagierte Gitarrenarbeit oder die sonore und treibende Bassarbeit von Martin Turner - das passt einfach.
Gemessenes: Die Canor überzeugt mit beeindruckender Linearität und Breitbandigkeit, ihr Übertragungsbereich reicht fast bis 200 Kilohertz. An acht Ohm-Lasten brilliert sie mit einem Fremdspannungsabstand von beeindruckenden 102 Dezibel(A) und einer Kanaltrennung von schwer zu schlagenden 99,6 Dezibel(A). Verzerren tut sie gar nicht: 0,0047 Prozent Klirr, alles bei einem Watt Ausgangsleistung bei einem Kilohertz gemessen. An vier Ohm ändert sich das Bild kaum, Störspannungsabstand und Kanaltrennung nehmen gerade einmal um drei Dezibel ab, der Klirr steigt auf 0,0058 Prozent. Interessant wird’s bei der Ausgangsleistung: Das Ding „drückt“ 280 Watt pro Kanal an acht und 480 Watt an vier Ohm, jeweils bei einer Klirrobergrenze von 0,7 Prozent. Stromverbrauch? Vorhanden: Im Leerlauf genehmigt sich die Virtus S1S rund 175 Watt aus dem Netz.
Mitspieler Plattenspieler:
- Thales Elegance / Simplicity II
Tonabhehmer:
Phonovorstufe:
Vorverstärker:
Lautsprecher:
- Klang + Ton Nada
- JBL 4301B
Gegenspieler Endverstärker:
Gespieltes - Wishbone Ash: Argus (45rpm)
- King Buffalo: Regenerator
- UFO: Live
- Afghan Whigs: Do To The Beast
 Die Front der großen Canor-Endstufe gibt sich pragmatisch
Die Front der großen Canor-Endstufe gibt sich pragmatisch
 Der beleuchtete zentrale „Knopf“ hat hier tatsächlich nur eine kosmetische Funktion
Der beleuchtete zentrale „Knopf“ hat hier tatsächlich nur eine kosmetische Funktion
 Fast 40 Kilo, fast 500 Watt pro Kanal: Das ist mal eine Endstufe
Fast 40 Kilo, fast 500 Watt pro Kanal: Das ist mal eine Endstufe
 Zweimal fünf Endtransistoren pro Kanal werkeln auf massiven Kupferschienen
Zweimal fünf Endtransistoren pro Kanal werkeln auf massiven Kupferschienen
 Netzteil und Kühlkörper erinnern an große amerikanische Verstärker vergangener Tage
Netzteil und Kühlkörper erinnern an große amerikanische Verstärker vergangener Tage
 Sogar bei der Lautsprecheleitung im Inneren ließ Canor sich nicht lumpen
Sogar bei der Lautsprecheleitung im Inneren ließ Canor sich nicht lumpen
 Die Lautsprecherklemmen sind ein ganz besonderes Kaliber
Die Lautsprecherklemmen sind ein ganz besonderes Kaliber
 Rückseitig gibt‘s alles, was man so braucht - und Bi-Wiring
Rückseitig gibt‘s alles, was man so braucht - und Bi-Wiring
 Die großen Netztrafos deuten schon an, welche Leistungen hier losgetreten werden können
Die großen Netztrafos deuten schon an, welche Leistungen hier losgetreten werden können
 Stromkompensierte Drosseln helfen bei der Erzeugung sauberer Betriebsspannungen
Stromkompensierte Drosseln helfen bei der Erzeugung sauberer Betriebsspannungen