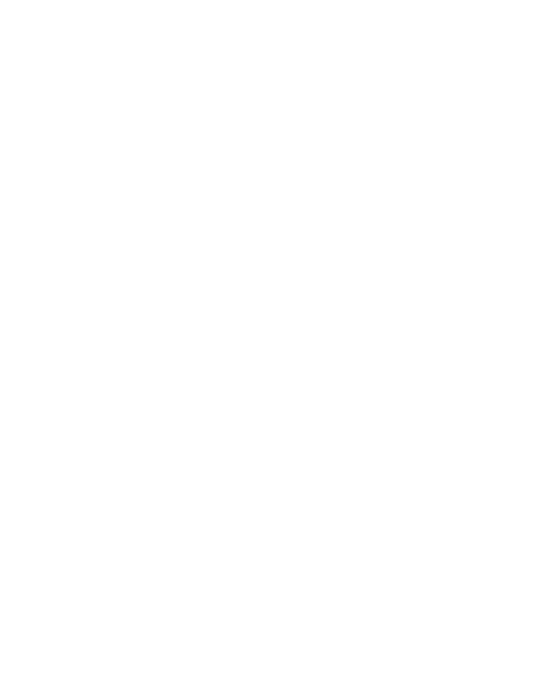Mit kaum einem Tonabnehmer verbinde ich eine so emotionale Beziehung wie mit dem Lyra Atlas. Ich war sogar mal soweit, mir eigens einen Plattenspieler dafür bauen zu lassen.
Tonabnehmer Lyra Atlas Lambda
Einleitendes
Was übrigens nicht geklappt hat. Nach – ich glaube – sieben Jahren Wartezeit habe ich die Hoffnung auf Realisation aufgegeben. Was rückblickend betrachtet vielleicht besser so war, denn das Atlas wollte kurz darauf zurück nach Japan. Thomas Fast, langjähriger Lyra-Vertrieb für Deutschland bot mir an, meinen Abschiedsschmerz mit dem Nachfolgemodell Atlas Lambda zu lindern, was ich natürlich mit Freuden akzeptiert habe. In den 13 Jahren, die ich das Ur-Atlas beherbergen durfte, war es zweimal „zur Kur“ zurück beim Hersteller, nachdem ich kleinere Probleme im Umgang mit dem Abtaster festgestellt hatte. Ich habe es lange Jahre intensiv benutzt, vielfach ein- und ausgebaut und immer in dem Momenten zum Einsatz gebracht, die einen ganz besonderen Abtaster angemessen erschienen ließen. Seine Ausdrucksstärke, seine nahezu magische Fähigkeit, den Kern der Musik zu transportieren wird mir immer in lieber Erinnerung bleiben. Das neue Lyra Atlas Lambda – wobei der Begriff „neu“ relativ ist, da es bereits 2020 offiziell vorgestellt wurde, findet seinen Weg zum Anwender in der praktisch gleichen grün-silbernen Kartonverpackung wir der berühmte Vorgänger. Was ich übrigens als sehr angenehm empfinde, die völlig überkandidelten gefrästen Aluminium-, Vollholz- und was-weiß-ich-nicht für- Verpackungen moderner Top-Abtaster sind nichts anderes als eine Verschwendung von Ressourcen und tragen garantiert kein Bisschen zur Qualität des Ergebnisses bei. Gewiss, mit 10.600 Euro ist das Atlas Lambda in der absolut irrsinnigen Tonabnehmerliga angesiedelt. Und ja, es handelt sich um ein Verschleißteil, zur Ehrenrettung muss man aber sagen, dass der Hersteller verschiedene Reparatur- und Auf- und Umbauoptionen anbietet, wenn mal etwas schiefgehen oder ein Update erscheinen sollte. Auch das ist nicht billig, relativiert die Preisgestaltung aber immerhin ein bisschen.
Bewährtes und Neues
Das Atlas war seinerzeit der erste Lyra- Abtaster, bei dem Designer Jonathan Carr die Asymmetrie zum Prinzip erhob. Dadurch wollte er Resonanzen minimieren, weil die Dinge auf beiden Seiten des Nadelträgers so unterschiedlich und weniger stark resonieren.
 Der Korpus des Lambda-Upgrades ist in dezentem Viloett gehalten
Der Korpus des Lambda-Upgrades ist in dezentem Viloett gehalten Dieser Aufbau findet sich auch beim Lambda, welches optisch ohnehin nur durch die geänderte Gehäusefarbe vom Vorgänger zu unterscheiden ist: früher war das vordere Korpusteil grün, beim Lamda ist in einem dezent dunklen Violett gehalten. Das Atlas folgte seinerzeit erstmals der „New Angle“-Technologie. Diese sorgt dafür, dass der Winkel zwischen Spulen und Magneten unter Last optimal wird. Die Dämpfung des Nadelträgers ist so ausgelegt, dass bei ruhendem Abtaster eine leichte Vorspannung nach unten vorherrscht, die für eine optimale Position der Spulen im Magnetfeld sorgt. Die ursprünglichen „New Angle“-Modelle erledigten dies mittels konischer Dämpfer. Bei der Lambda-Revision übernehmen flache Elastomerscheiben und Stützkissen diesen Job, wodurch sich die Dämpfungsparameter deutlich genauer einstellen lassen. Hüben wie drüben dient ein solider asymmetrisch geformter Titankorpus als Basis für den Abtaster. Die Lambda-Überarbeitung bedingte eine geänderte innere Struktur des Gehäuses und ein „Phaseninterferenz- Resonanzkontrollsystem“ (von dem ich nicht genau weiß, was es tut). Das Resultat: mehr Kontrolle über Störresonanzen. Außerdem wurde der Montagebereich verändert, so dass der Kontakt zwischen Abtaster und Headshell noch stabiler ist.
Generator All diese Änderungen beim Atlas Lambda sind rein mechanischer Natur. Der Generator selbst blieb dem Vernehmen nach praktisch unverändert. Was zum Beispiel zu Folge hat, dass sich ein „altes“ Atlas zu hundert Prozent auf Lambda-Standard upgraden lässt. Beide liefern eine nominelle Ausgangsspannung von 0,56 mV bei einer Schnelle von 5 cm/s. Liegen also im mittleren Ausgangsspannungsbereich. Mit einer MC-Verstärkung von rund 60 Dezibel ist man bestens für den Betrieb gerüstet, diese 60 Dezibel sollten allerdings vom Feinsten sein. Der Hersteller empfiehlt eine Abschlussimpedanz zwischen 104 und 887 Ohm, dazwischen dürfen Einbausituation und persönlicher Geschmack entscheiden. Bei uns im Hörraum bin ich letztlich bei 300 Ohm gelandet, wobei sich das Lambda als ziemlich sensibel nicht nur für diesen Parameter erwiesen hat. Sorgfalt bei der Einstellung des VTA (hier hat sich ein exakt waagerecht justierter Tonarm als optimal erwiesen) honoriert das Lambda mit ungeheurer Transparenz und Feingeistigkeit, hier hat sich ein Linienlaser als Justagehilfe wieder einmal sehe bewährt. Mit 4,2 Ohm Innenwiderstand zählt das Lambda zu den niederohmigen Abtastern, was einen Betrieb am Übertrager möglich und sinnvoll erscheinen lässt. Habe ich noch nicht probiert, wird aber sicherlich noch kommen. In diesem Zusammenhang sei die Existenz einer noch „radikaleren“ Variante dieses Abtasters erwähnt: Lyra fertigt noch eine „SL“ („Single Layer“)- Version, deren Spulen nur über eine einzige Lage Draht verfügen. Dafür gibt’s dann auch nur 0,25 Millivolt Ausgangsspannung. Die SL-Variante gilt als noch sensibler und soll schwieriger auf Höchstleitung zu trimmen sein, mag aber ob der geringeren bewegten Mass klanglich hie und da Vorteile haben.
Klang Bei dem, was das Lambda unter dem Headshell des Thales Elegance II abliefert, scheint mir das kaum vorstellbar. Es ist auf eine spektakuläre Weise neutral und unverfärbt. In den ersten Momenten habe ich ein bisschen die Leuchtkraft und Farbigkeit des Ur-Atlas vermisst, das aber wohl zu Unrecht: Das Lambda spielt mit der Feingeistigkeit und Akkuratesse der großen Ortofon-Abtaster mit dem berühmten Replikant 100-Diamanten, liefert aber den Punch und die Geradlinigkeit des Etna Lambda. Ihm einen klanglichen Charakter zuzuordnen ist gar nicht leicht, weil es sich in extremem Maße der Information in der Rille unterordnet. Ich darf mal etwas zur Evaluierung der Fähigkeiten dieses Abtasters vorschlagen? Dominic Miller, „Silent Light“ aus dem Jahre 2017. Akustische Gitarre, hier und da ein bisschen Percussion, Schlagzeug und Bass. Live und (fast) ohne Overdubs von einem der ganz Großen eingefangen: Jan Erik Kongshaug höchstselbst stellte sich und seine legendären Rainbow-Studios in den Dienst von ECM. Das Ergebnis ist ein Kunstwerk von zerbrechlicher Schönheit und zarter Eleganz, welche das Atlas Lambda in wohl einmalig anmutiger Eleganz strahlen lässt. Klar könnte ich jetzt über das Ausschwingen von Tönen schwadronieren, die Ruhe und Komzentration rühmen, mit der hier dargeboten wird, aber das ist alles nur ein Schwadronieren um den heißen Brei. Der springende Punkt an diesem Abtaster ist, dass er bei aller Zartheit und Filigranität mitreißt und verzaubert,nie den Pfad der Tugend verlässt und einfach alles ein bisschen besser macht.
Mitspieler Plattenspieler:
- Thales Elegance / Simplicity II
Tonabhehmer:
Phonovorstufe:
Vollverstärker:
Lautsprecher:
- Klang + Ton Nada
- JBL 4301B
Gegenspieler Tonabnehmer:
- Lyra Etna Lambda
- EMT JSD 6
Gespieltes - Dominic Miller: Silent Light
- Wishbone Ash: Argus (45rpm)
- John Coltrane: A Love Supreme
- Chick Corea: Return To Forever
 Das Atlas baut auf einem Titanträger mit eingelassenen Messinggewichten auf
Das Atlas baut auf einem Titanträger mit eingelassenen Messinggewichten auf
 Wie bei Lyra üblich, dient ein Stück Washi-Papier als Generatorabdeckung
Wie bei Lyra üblich, dient ein Stück Washi-Papier als Generatorabdeckung
 Der Korpus des Lambda-Upgrades ist in dezentem Viloett gehalten
Der Korpus des Lambda-Upgrades ist in dezentem Viloett gehalten
 Der Nadelschutz ist problemlos zu montieren und zu entfernen und seit vielen Jahren bei Lyra bewährt
Der Nadelschutz ist problemlos zu montieren und zu entfernen und seit vielen Jahren bei Lyra bewährt